|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||
![]()

Institute
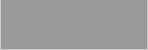
|
Der Afrika-Verein residiert im Hamburgischen |
|
Weltwirtschaftsarchiv am Jungfernstieg in guter |
|
Nachbarschaft mit anderen Instituten, die deutsche |
|
Unternehmensinteressen in aussereuropäischen |
|
Ländern vertreten. 1934 wurde der Afrika-Verein |
|
als Bündnis der hanseatischen Afrika-Wirtschaft |
|
gegründet. Er unterstützte aktiv die Politik des |
|
Naziregimes zur Rückgewinnung der Kolonien |
|
und die südafrikanische Nationalpartei bei der |
|
Etablierung des Apartheid, der Rassentrennung. |
|
Heute fördert der Afrika-Verein Business |
|
Development GmbH privatwirtschaftliche Interessen |
|
deutscher Firmen in Afrika, die entwicklungspolitisch |
|
fragwürdig sind. |



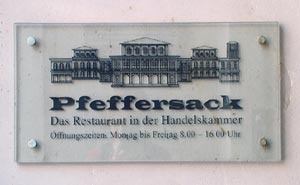

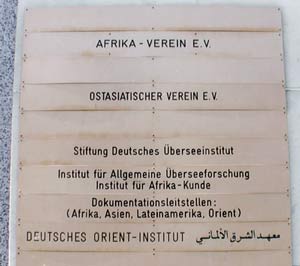
|
Die Handelskammer mit der Börse Hamburgs. |
|
Die Symbiose zwischen Wirtschaft und Politik ist |
|
eng, abzulesen auch am Gebäudekomplex: vorne das |
|
Rathaus, hinten der Sitz der Kaufmannschaft. In der |
|
Mitte befindet sich ein Innenhof, an dessen Fassade |
|
Allegorien der Kontinente hanseatische Übersee- |
|
Begehrlichkeiten symbolisieren. Die Handelskammer |
|
war die Schaltstelle des Hamburger Überseehandels. |
|
Sie spielte eine überaus wichtige politische Rolle bei |
|
der Durchsetzung der Unternehmensinteressen sowohl |
|
in den Kolonien als auch im Berliner Reichstag. |
|
In den 1960er Jahren veränderte sich rapide die |
|
wirtschaftspolitische Situation in Afrika: einerseits |
|
begann für viele Staaten die Unabhängigkeit, anderer- |
|
seits drängten multinationale Konzerne auf die |
|
Märkte. Um auf die neue Lage zu reagieren, gründete |
|
der Afrika-Verein 1963 das Institut für Afrika-Kunde, |
|
das im Gebäude des HWWA untergebracht ist. |
|
Im neuen Institut setzten sich aber jüngere Wissen- |
|
schaftlerInnen kritisch mit entwicklungspolitischen |
|
Fragen auseinander. Der Afrika-Verein zog die |
|
Trägerschaft zurück. |
|
Als Gebäude-Ensemble entstand die 'Hafenkrone' |
|
am Elbhang oberhalb der Landungsbrücken. Vom |
|
Bismarck-Denkmal bis zum Tropeninstitut zeigte Hamburg |
|
seine Weltgeltung. Die festungsartige 'Deutsche |
|
Seewarte', die dort war, wo jetzt die Jugendherberge |
|
steht, plante die Seerouten im Atlantik. 'Hotel Hafen |
|
Hamburg' war früher ein Seemannshaus. |

|
1905 wurde die prominente Navigationsschule an der |
|
'Hafenkrone' gebaut. Die rückseitige Fassade des |
|
Neorenaissance-Prunkbaus ist mit Namen berühmter |
|
Seefahrer verziert. Mit diesem repräsentativen Baustil |
|
wollte Hamburg zeigen, dass im Überseehandel die |
|
Zukunft Deutschlands liege. |
|
In der Hoffnung, erneut Kolonien erobern zu können, |
|
förderte ab 1937 das Naziregime verstärkt tropen- |
|
medizinische Studien. Die Ärzte des Tropeninstituts |
|
schreckten auch nicht davor zurück, gefährliche |
|
Versuche an Behinderten und KZ-Häftlingen |
|
durchzuführen, die nicht selten zum Tode führten. |
|
Das Institut für Schiffs- und Tropenkrankheiten wurde |
|
1900 gegründet und am Elbhang neben der |
|
Navigationsschule gebaut. Erster Institutsleiter |
|
wurde der Hafenarzt Bernhard Nocht. Den Forschungs- |
|
schwerpunkt bildete die Gesundhaltung der kolonialen |
|
Kampftruppen und Erhaltung der Arbeitskraft der |
|
Kolonisierten. Experimente mit Medikamenten und |
|
Impstoffen, die z.T. schwere Nebenwirkungen hervor- |
|
riefen, wurden an menschlichen Testpersonen in Afrika |
|
durchgeführt. In den Krankenpavillons des Instituts |
|
wurden farbige und weiße Patienten getrennt unter- |
|
gebracht. Zum 'Freundeskreis' des Instituts gehörten |
|
Hamburger Kolonialhändler. |
|
Mehr zu > kolonialmedizinischen Menschenversuchen |