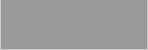|
|
Textauszug aus Thomas Pynchons Roman 'V.', Rowohlt, Reinbek 2001, S. 287-290 |
 |
|
Der amerikanische Autor Thomas Pynchon beschreibt im Folgenden eine fatale Begegnung auf den Haifischinseln vor der Lüderitzbucht in der damaligen Kolonie "Deutsch-Südwestafrika". Nach dem Völkermord an den Herero und Nama, nach der Niederschlagung ihres Aufstandes, durften ab 1907 die wenigen Überlebenden aus der Omaheke-Wüste zurückkehren. Die Schutztruppenkommandanten versprachen, dass ihnen kein Leid mehr zugefügt würde, hielten aber ihr Wort nicht: die Zurückkehrenden wurden in Konzentrationslagern gefangen gehalten und zur Zwangsarbeit in Bergwerken, beim Eisenbahnbau und auf Plantagen geholt. Auf den Haifischinseln befand sich das berüchtigste Lager: harte Arbeit, Prügelstrafen und körperliche Nötigung waren auf der Tagesordnung; Hunger, Durst und extreme klimatische Verhältnisse führten zu einer hohen Sterblichkeitsrate unter den Gefangenen. Mehr zur Kolonialgeschichte |
 |
|
"Er selbst hätte in dieser neuen Gemeinschaft glücklich sein können, hätte sicher auch als Baumeister seine Karriere gemacht, wäre da nicht dieses Hereromädchen, seine Konkubine Sarah, gewesen. Sie brachte seine Verzweiflung zu einem Höhepunkt; vielleicht war sie auch eine der Ursachen dafür, daß er alles im Stich ließ und ins Landesinnere zog, um doch noch ein wenig von dem Luxus und Überfluß wiederzufinden, der - so glaubte er - mit von Trotha verschwunden war. |
 |
|
Er sah sie zum erstenmal draußen im Atlantik, auf dem Wellenbrecher, den sie mit den glänzenden schwarzen Steinbrocken bauten, die die Frauen dort hinaustrugen und mühsam und kaum vorankommend zu dem sich langsam ins Meer voranschiebenden Fühler aufschichteten. An diesem Tag war der Himmel grau verhangen, und eine schwarze Wolke lag unbeweglich über dem westlichen Horizont. |
 |
|
Es waren ihre Augen, die er zuerst sah - das Weiße in ihnen reflektierte ein wenig die träge Turbulenz des Meeres -, dann ihren von alten Peitschennarben bedeckten Rücken. Er hielt es für nackte Begierde, die ihn zu ihr hinübergehen und den Steinquader aus dem Arm nehmen ließ: kritzelte etwas auf einen Zettel, gab ihn ihr mit dem Auftrag, ihn ihrem Lageraufseher zu bringen. "Tu es", warnte er sie, "oder . . .", und ließ seinen Schambok durch den Salzwind pfeifen. In früheren Zeiten hatte man sie nicht warnen müssen: irgendwie wohl entsprechend jenem "funktionalen Übereinkommen" übergaben sie alle Briefe, selbst wenn sie wußten, daß sie vielleicht ihr eigenes Todesurteil enthielten. |
 |
|
Sie sah auf den Zettel, dann auf ihn. Wolken zogen über diese Augen; er erfuhr nie, ob sie von ihr widergespiegelt oder in ihr entstanden waren. Salzwasser schlug gegen ihre Füße, Aasgeier kreisten am Himmel. Das Brackwasser hinter ihnen zog sich hin bis zum Land, zur Sicherheit. Doch es schien nur eines Wortes zu bedürfen, irgendeines, sogar des unvernünftigsten, um in ihnen den perversen Eindruck entstehen zu lassen, daß ihr Weg in die andere Richtung führte, über die unsichtbare, noch nicht errichtete Mole; als wäre die See ihnen ein sicherer Weg wie einst unserem Erlöser. |
 |
|
Hier hatte er ein anderes Stück seiner Soldatenzeit gefunden, wie damals die Frau unter der Eisenbahnschiene. Er wußte, daß er dieses Mädchen nicht mit anderen teilen wollte, er fühlte wieder die Freude, eine Wahl treffen zu dürfen, deren Folgen, nicht einmal die entsetzlichsten, er nicht wissen konnte. |
 |
|
Er fragte sie nach ihrem Namen, sie sagte, sie heiße Sarah; ihre Augen wandten sich keinen Augenblick lang von ihm ab. Ein Luftzug, kalt wie Antarctica, kam über das Wasser gehuscht, durchdrang sie und flog nordwärts weiter, doch er würde ersterben, bevor er noch die Kongomündung oder die Bucht von Benin erreichen konnte. Sie fröstelte, seine Hand - offensichtlich in einer Reflexbewegung - wollte sie berühren, doch sie wich ihr aus, bückte sich und hob den Stein wieder auf. Er klopfte ihr leicht mit dem Griff seines Schambok auf den Rücken, und die Szene - was eigentlich hatte sie bedeutet? - war vorüber. |
 |
|
In dieser Nacht kam sie nicht. Am nächsten Tag griff er sie sich auf dem Wellenbrecher, ließ sie niederknien, setzte seinen Fuß in ihren Nacken, stieß sie mit dem Kopf unter Wasser und ließ sie erst dann wieder Luft holen, als sein Zeitgefühl ihm sagte, dass es höchste Zeit dazu wäre. Er sah, wie lang und schlangenhaft ihre Beine waren, wie klar ihre Hüftmuskeln unter der Haut standen, einer Haut, die glänzte und die doch nach der langen Zeit des Hungerns in der Steppe ein wenig gerunzelt war. An diesem Tag würde er sie beim geringsten Anlaß auspeitschen. Als es dunkelte, schrieb er einen zweiten Zettel und gab ihn ihr. "Eine Stunde gebe ich dir." Sie blickte ihn an, und nichts an ihr erinnerte ihn an das Animalische, das er in anderen Negerfrauen gesehen hatte. Nur die Augen reflektierten die rote Sonne und die weißen Nebelschwaden, die jetzt schon aus dem Wasser emporzusteigen begannen. |
 |
|
Er aß nicht zu Abend. Er wartete in seinem Haus nahe des Stacheldrahtlagers, hörte, wie die Betrunkenen ihre Bettgenossinnen auswählten. Er konnte nicht ruhig bleiben, vielleicht hatte er sich eine Erkältung geholt. Die Stunde verstrich: sie kam nicht. Ohne Mantel ging er hinaus durch die tiefhängenden Wolken zum Dornheckenlager. Es war eine pechschwarze Nacht. Feuchte Windstoße schlugen ihm ins Gesicht, er stolperte. Am Lager angekommen, nahm er sich eine Fackel und suchte sie. Vielleicht hielten sie ihn für verrückt, vielleicht war er es. Er wußte nicht, wie lange er suchte. Er konnte sie nicht finden. Sie ähnelten sich alle. |
 |
|
Am nächsten Morgen erschien sie wie immer. Er wählte sich zwei kräftige Frauen aus, ließ Sarah sich über einen Stein beugen, und während die Frauen sie festhielten, peitschte er sie zuerst, dann nahm er sie. Sie lag da, kalt und starr; als es vorbei war, bemerkte er erstaunt, daß die beiden anderen, wie erfahrene Anstandsdamen, sie unterdessen losgelassen und sich wieder an die Arbeit gemacht hatten. Und in dieser Nacht, lange nachdem er nach Hause gegangen war, kam sie und schlüpfte neben ihm ins Bett. Weibliche Perversität! Sie gehörte ihm. |
 |
|
Doch wie lange konnte er sie für sich allein behalten? Tagsüber fesselte er sie ans Bett, und er holte sich auch weiter Frauen aus dem Lager, um keinen Verdacht zu wecken. Sarah hätte für ihn kochen und putzen, hatte es ihm behaglich machen konnen, wäre vielleicht das Weiblichste gewesen, das er je gehabt hätte. Doch an dieser nebligen, schwitzenden, sterilen Küste gibt es keinen Besitz und keine Besitzer. Das Leben in der Gemeinschaft ist wohl die einzige Möglichkeit, gegen eine solche Bastion des Unbeseelten ankommen zu können. Nur allzu bald hatte sein schwuler Nachbar sie entdeckt und Gefallen an ihr gefunden. Auch er wollte sie haben, aber er bekam zur Antwort, sie stamme aus dem Lager, und er so!le warten, bis er an die Reihe käme. Doch dadurch konnte er nur eine Verzögerung erreichen. Der Nachbar kam während des Tages in sein Haus, fand sie dort, gefesselt und hilflos, nahm sie auf seine Weise und beschloß dann, wie ein grogzügiger Unteroffizier seine schöne Beute mit seinen Kameraden zu teilen. Zwischen Mittag und Abend, während sich der hellglänzende Nebel über den Himmel schob, unterzogen sie die arme Sarah einem Übermaß abartiger sexueller Praktiken; 'seine' Sarah allerdings war sie nur in einer Weise, die dieser vergiftete Küstenstreifen niemals dulden durfte. |
 |
|
Als er nach Hause kam, lief ihr der Speichel über die Lippen, und aus ihren Augen war alles, was sie früher widerspiegelten, verschwunden. Er konnte nicht denken, begriff vielleicht nicht einmal, was vorgefallen war, doch er löste ihre Fesseln: es war, als schnellte eine Feder hoch, in der noch zusätzlich all die Kraft steckte, die die ausgelassene Gruppe bei ihren Vergnügungen verausgabt hatte; denn mit unglaublicher Kraft befreite sie sich aus seiner Umarmung und floh. Er hatte sie zum letzten mal lebend gesehen. |
 |
|
Am nächsten Tag wurde ihr Leichnam an die Küste gespült. Sie war in einem Meer gestorben, das sie vielleicht nie - nicht einmal teilweise - bändigen würden. Schakale hatten ihre Brüste gefressen. Es schien, als habe sich etwas vollendet, das seit seiner Ankunft an Bord des Truppentransporters 'Habicht' vor Jahrhunderten begonnen hatte... |
 |
|
S. 291 |
|
... eine Sonne ohne Umriß, eine Küste, dle ihm fremd war wie die Antarktis des Mondes, unzufriedene Konkubinen hinter Stacheldraht, salziger Dunst, alkalische Erde, eine Benguela-Strömung, die nie aufhören würde, Sand heranzuschwemmen, um den Grund des Hafenbeckens zu heben, die Starre der Felsen, die Gebrechlichkeit des Fleisches, die strukturelle Unzuverlässigkeit der Dornen; das ungehörte Stöhnen einer sterbenden Frau; der schaurige, doch notwendige Schrei des Strandwolfs im Nebel." |
|
|
|
![]()